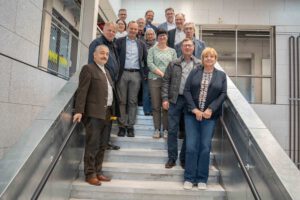
Zwei Tage lang diskutierten Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft im InnovationSPIN auf dem Innovation Campus Lemgo über aktuelle Forschungsfragen rund um den Anbau und die Nutzung von Öl- und Eiweißpflanzen. Im Mittelpunkt standen neue Wege zur nachhaltigen Proteinversorgung – und die Rolle der TH OWL als Impulsgeberin für innovative Lebensmitteltechnologien. Foto: TH OWL
Erweiterter UFOP-Fachbeirat tagt an der TH OWL
Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) war am 30. September und 1. Oktober Gastgeberin für die Sitzung des Erweiterten Fachbeirats der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP).
Zwei Tage lang diskutierten Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft im InnovationSPIN auf dem Innovation Campus Lemgo über aktuelle Forschungsfragen rund um den Anbau und die Nutzung von Öl- und Eiweißpflanzen. Im Mittelpunkt standen neue Wege zur nachhaltigen Proteinversorgung – und die Rolle der Hochschule als Impulsgeberin für innovative Lebensmitteltechnologien.
Gastgeber Professor Dr. Jürgen Krahl, Präsident der TH OWL, betonte, wie eng Forschung und Praxis an der Hochschule verzahnt sind: „Wir verstehen uns als Brücke zwischen landwirtschaftlicher Produktion, industrieller Verarbeitung und nachhaltigem Konsum. Genau an dieser Schnittstelle entstehen die Innovationen, die wir für die Ernährung der Zukunft brauchen.“
Einen ersten inhaltlichen Schwerpunkt setzte Professorin Dr. Susanne Struck, sie stellte das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) geförderte Projekt PLANTEIN vor.
Im Vorhaben werden neue Einkommensalternativen für landwirtschaftliche Betriebe durch die Nutzung pflanzlicher Proteine erforscht. Im Fokus stehen sieben sogenannte nicht-legume Pflanzen – Sonnenblume, Amaranth, Quinoa, Körnerhanf, Leinsamen, Chia und Raps. Ziel ist es, Proteine aus diesen Rohstoffen zu extrahieren und zu konzentrieren, um sie in marktfähige Lebensmittelprodukte zu überführen. Der gesamte Prozess – vom Anbau über die Ernte bis zur Verarbeitung – wird in enger Zusammenarbeit mit Demonstrationsbetrieben und regionalen Partnern entwickelt.
Das Projekt knüpft an eine der großen Zukunftsfragen an: Wie lassen sich nachhaltige Ernährungssysteme mit heimischen Pflanzen gestalten? Auch der erweiterte Fachbeirat der UFOP suchte dazu in einem intensiven Brainstorming Antworten, die in einem neuen UFOP-Positionspapier münden sollen. Unter Leitung von UFOP-Geschäftsführer Stephan Arens diskutierten die Mitglieder Forschungsbedarfe rund um den Raps – eine Kulturpflanze mit großem Potenzial für Ernährung, Energie und Klimaschutz.
Impulse kamen aus den Bereichen Produktionsmanagement, Markt und Ökonomie, Human- und Tierernährung sowie nachwachsende Rohstoffe. Professor Krahl brachte dabei die Perspektive der Hochschule ein: „Raps ist mehr als ein Ölträger – er kann Baustein einer ganzheitlichen Bioökonomie werden, wenn wir alle Nutzungspfade klug verknüpfen.“
Für Anfang 2026 ist ein erster Entwurf des Positionspapiers geplant. Ergänzend sollen in Kooperation mit der Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation (GFPi) auch Fragen der Pflanzenzüchtung einfließen. Ergänzend sollen im Austausch mit der ölsaatenverarbeitenden Industrie alternative Ölgewinnungsverfahren beleuchtet werden.
Am zweiten Sitzungstag standen aktuelle politische Entwicklungen im Mittelpunkt. Arens informierte über den Stand der Erarbeitung einer Nationalen und Europäischen Proteinstrategie, bevor Christian Grütters vom Deutschen Raiffeisenverband ein Update zur Treibhausgas-Bilanzierung und zu Nachhaltigkeitsanforderungen im Lebensmittel- und Futtermittelsektor gab. Die Teilnehmenden diskutierten intensiv über Chancen und Herausforderungen einer klima- und ressourcenschonenden Landwirtschaft.
Zum Abschluss der Tagung führte Professor Krahl durch die Forschungseinrichtungen auf dem Innovation Campus Lemgo. Besonders eindrucksvoll: die Future Food Factory OWL, die Produktionsprozesse der Lebensmittelindustrie unter realen Bedingungen simuliert. Hier arbeiten Studierende, Forschende und Unternehmen gemeinsam an Lösungen für die Nahrungsmittelproduktion von morgen. Ebenso besichtigt wurde das neue Laborgebäude 16 der Life Science Technologies – ein weiteres Beispiel für die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Lemgo.
Das Urteil der Gäste fiel entsprechend positiv aus: Die Hochschule zeige beispielhaft, wie interdisziplinäre Forschung und regionale Vernetzung Hand in Hand gehen. Damit sei Lemgo ein idealer Ort, um die Zukunft pflanzlicher Proteine nicht nur zu diskutieren, sondern praktisch zu gestalten.
Pressemeldung: TH OWL

















